Die Genferinnen und Genfer wollen etwas von ihren Ufern haben. Seit zehn Jahren bevölkern sie zunehmend die Flussufer der Rhone. Sie baden dort wieder, so wie es im Mittelalter üblich war – oder wie es seit Jahrzehnten in der Aare in Bern oder im Rhein in Basel alltäglich ist. Seit dem 22. Juni verfügt nun Genf auch über einen neuen Strand, jenen von Eaux-Vives. Die öffentliche Anlage mit ihrer Länge von insgesamt 500 Metern liegt zehn Gehminuten vom Zentrum entfernt und wird im Frühling 2020 fertiggestellt sein. Zwischen See und Land umfasst sie – wie vom WWF gefordert – einen Wassergarten mit seltenen Pflanzen und einen Park. Der neue Ruhepol umfasst weiter eine grosse Esplanade für Segelboote, ein Fischerdorf und ein Restaurant direkt gegenüber Genfs Springbrunnen, dem Jet d’Eau.
Was den Hafen der Société Nautique und ihren Club angeht, so wurde dieser von 600 auf 1000 Anlegeplätze vergrössert. Ein langer Deich zieht sich als Schutz der Anlage ins offene Wasser hinaus. Der Deich weckte auch Bedenken: So könne sich das Wasser für die Badenden nicht genügend umwälzen, wird moniert. Der Kanton dementiert dies. «Man muss etwas riskieren und vorangehen», sagt der Architekt Marcellin Barthassat, der in den 1990er-Jahren an der Renovation der Bains de Pâquis auf der anderen Seeseite beteiligt war.
Yverdon und Zürich beobachten Genf
«Der Blick auf das Seebecken ist aussergewöhnlich; vor dem Verkehr geschützt findet man dort Ruhe», sagt Projektleiter Franck Pidoux. Er ist im Kanton Genf für die Renaturierung von Wasserläufen zuständig und weist darauf hin, dass schon vor Jahren mit Petitionen ein besserer Seezugang gefordert worden sei. «Wir hatten am Genfersee punkto Wasserzugang das schlechteste Angebot, anders als zum Beispiel in den Städten Bern und Zürich, die ihre Verbindung zu ihren Gewässern nie verloren haben», fasst er zusammen. Ein neuer Seezugang? Das Vorhaben ist heikel, weshalb sich auch Vertreter der Städte Yverdon und Zürich das Projekt angeschaut haben, «um zu verstehen, wie es die Genfer geschafft haben, eine Anlage auf dem See zu bauen, was allein schon aus gesetzlichen Gründen die grosse Ausnahme ist», erklärt der Projektleiter.
Badehäuser im Genfersee
Die Beziehung der Stadt Genf zu ihren Ufern ist wechselvoll. «Im Mittelalter hatten die Menschen keine Angst vor dem Wasser. Genf verfügte über Badehäuser an der Rhone, warme Bäder, die Orte der Begegnung waren. Mit der Reformation wurden sie verboten. Im Übrigen badeten die Genferinnen und Genfer im Laufe der Zeit trotz Verbot auch nackt in der Rhone», erzählt Historiker Bernard Lescaze. «Was den Genfersee betrifft, so wurde dieser als Hafen und für die Industrie genutzt, bis im 18. Jahrhundert schliesslich die ersten Seebäder entstanden. Ab 1850 verlor der See seine kommerzielle Bedeutung und nach 1900 wurde er von der Freizeitschifffahrt und den Regatten erobert.» Das Baden in der Rhone erlebte eine andere Entwicklung. «Vor dem Krieg traf sich die Arbeiterklasse in den Bains des Pâquis, während in Genève-Plage am linken Ufer Schönheitswettbewerbe abgehalten wurden», fasst Bernard Lescaze zusammen, der die Entwicklung einer «Freizeit- und Wasserzivilisation» beschreibt.
Zuhause am Strand statt Fernflüge
Die Eröffnung des neuen Strandes von Eaux-Vives kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt für die Stadtentwicklung. «Wir brauchen einen weiteren Strand, um auf gesellschaftliche Entwicklungen und auf die Klimaerwärmung zu reagieren», sagt Architekt Marcellin Barthassat. Die Einrichtung neuer öffentlicher Räume in den Städten sei wichtig, auch um Reisen ans Ende der Welt zu verhindern. «Die urbane Aufwertung ist eines der grossen Themen der Stadtentwicklung. Wir beobachten, dass die Zahl der Jungen, die die Fahrprüfung ablegen, sinkt und dass die Digitalisierung die Mobilität verändert.»
Genf sei wahrlich einen weiten Weg gegangen, sagt Franck Pidoux. Die Wende zum Besseren sei wohl mit dem Referendum zur Rettung der Bains des Pâquis im Jahr 1987 erfolgt: «In den Sechziger-, Siebziger- und Achtzigerjahren war der See stark verschmutzt. Man badete in Schwimmbädern. Die Situation hat sich gewandelt, der See ist zu einem Gewässer von sehr guter Qualität geworden. Er zieht immer mehr Menschen an und die Stadt muss auf diese Nachfrage reagieren.»
Nähe zum Wasser im Norden
In der Deutschschweiz sei der Zugang zum Wasser «direkter und unverkrampfter», sagt Marcellin Barthassat. Als Beispiele führt der Architekt die Renaturierungsarbeiten entlang der Limmat in Zürich, den ungehinderten Seezugang durch die Pärke sowie die Bäder an der Aare in Bern an. In Genf bleiben Hunderte Meter der Quais durch Steinschüttungen oder Mauern versperrt.
Etliche Genferinnen und Genfer empfinden den Bau des Strandes von Eaux-Vives allerdings als ein Sakrileg, da ihm ungefähr zwei Hektaren der Seefläche zum Opfer fallen – bei geschätzten Gesamtkosten von 67 Millionen Franken. Dies «für eine Badesaison, die von Juni bis September dauert», kritisiert Bernard Lescaze. «Ja, wir verlieren einen Teil des Sees, aber der Kanton kompensiert dies, indem er mit dem Wassergarten die Artenvielfalt erhöht und Renaturierungen an anderen Orten im Kanton fördert», entgegnet Franck Pidoux.
Ein Strand, der das Seebecken komplett verändert
Das Projekt des Strandes von Eaux-Vives, das vom ehemaligen Ständerat und Umweltschützer Robert Cramer vorangetrieben und vom WWF mit einer Einsprache verzögert wurde, hat seinen Ursprung in einer in den 1990er-Jahren lancierten Studie. «Das Projekt Fil du Rhône betrachtete damals die Flussufer aus der Sicht des öffentlichen Raums und sah Eingriffe durch Architekten, Ingenieure und Künstler vor», fasst Marcellin Barthassat zusammen. Für Cramer ging es einerseits darum, auf die Société Nautique zu reagieren, die ihren privaten Club vergrössern wollte. Anderseits wollte er den Seezugang für alle sicherstellen. Und schliesslich ging es ihm darum, die dem Jet ’d Eau nachgelagerten Quais neu zu gestalten. Diese hatten sich unkontrolliert entwickelt. Das Projekt gab schliesslich den Anstoss für einen Ideenwettbewerb. Der erste Wettbewerbsgewinner schlug rund um das Seebecken kleine Inseln nach dem Vorbild der Bains des Pâquis vor, die den Zugang zum Wasser begünstigten. Der zweite sah Seezugänge für Fussgänger vor. Nun werden auf jeden Fall Teile der alten Quais, des alten Hafens und der historischen Gewerbe – Fischerei und Schiffbau – verschwinden. Dies enttäuscht manche Genferin, machen Genfer. «Was wird aus dieser Leere? Müssen Sozialarbeiter zur Belebung der Quais angestellt werden? Das ist noch offen», sagt Marcellin Barthassat.

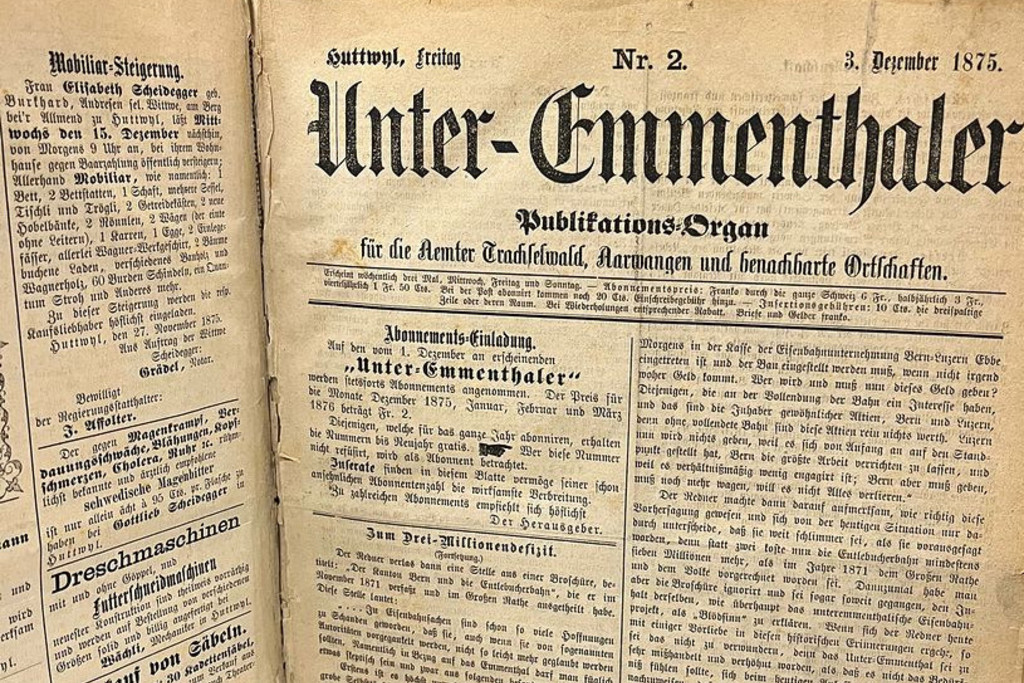











Kommentare
Kommentare :